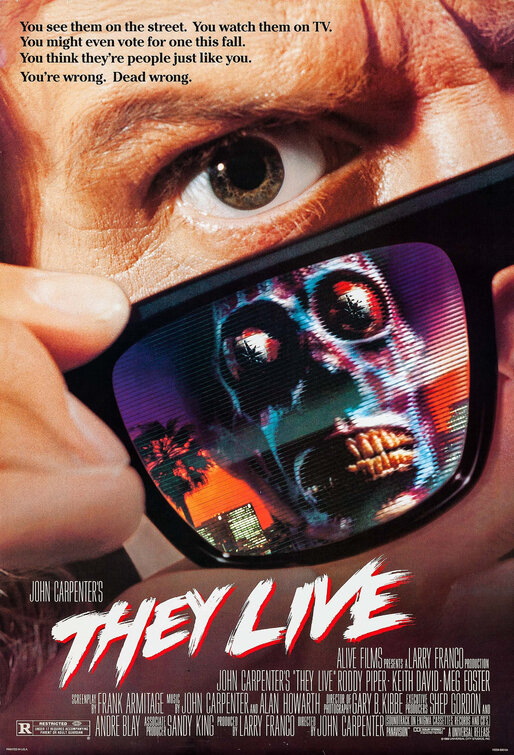Historie | Auszüge aus den Beiträgen von Peter Hermann Loosen, Matthias Stevens und Otto Trebels zur Festschrift anläßlich des 75-jährigen Bestehens der Bühne im Jahr 1996. |
| Vorgeschichte: | Die ältesten Zeugnisse des Aachener Puppenspiels stammen aus den Jahren 1770 - 1780, doch ist aus Urkunden zu ersehen, daß schon bedeutend früher in Aachen ein Puppenspiel bestanden hat. Wie überall in Deutschland findet auch in Aachen das Puppenspiel nicht gleich den richtigen Weg in die närrische Welt, wo es eigentlich zu Hause ist. Der Umweg geht über Spiele geistlichen Inhaltes, die dem Puppentheater für Jahrhunderte den Namen "Krippenspiel" oder "Krepche" geben. Welchen Anklag das Puppentheater in seinen mannigfaltigen Formen, sei es als Wanderbühne, sei es als bodenständiges, berufsmäßiges Spiel, sei es als Privatbühne, im Volke gefunden hat, zeigt eine Fülle von Sprachresten der Aachener Mundart: "Met enge Krepehännesje speäle" (einem zum Narren halten, auch wohl: nicht viel Federlesens mit einem machen), „Do es et rechtig Krepche bejeä" (da ist eine saubere Gesellschaft beisammen). „Doe sönd de Poppen an et danze!" (da ist allerlei los), „Ene Schelm ejjene Mau han" (ein Witzbold sein). Für Krepche gibt Prof. Rovenhagen in seinem „Wörterbuch der Aachener Mundart" als hochdeutsche Bedeutung an: 1. Weihnachtskrippe, 2. Puppenspiel, 3. Scherz, Spaß, 4. Hansnarr. 
An Schimpfnamen haben sich erhalten: „jecke Marionett", „Hanswoesch" (nach dem Nürnberger Puppenhelden Hanswurst), „Hannskasper" (nach dem Münchener Hannskasper oder dem mitteldeutscheu Kasperl), „Deä es stabeljeck!" (nach dem Wiener Staberl), „Jampetaatsch" (nach dem französischen Jean Potage), „Aapeklössje" (nach dem holländischen Puppenhelden Jan Klaasje). Alle diese Sprachreste zeigen, daß aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands und der Nachbarländer Puppenspieler nach Aachen kamen und hier ihre Künste zeigten, und daß die Bevölkerung regen Anteil an ihnen genommen hat. |
| Gründer: | Eigentlich hat das „Öcher Schängchen", der Aachener Puppenheld, gleich fünf Väter, was an sich ganz seiner absonderlichen Art entspricht - einer dieser „Väter" aber war Schängchens eigentlicher geistiger Urheber: Prof. Dr. Will Hermanns, der bekannter Aachener Heimatdichter. Er hat ihm seinen Namen gegeben, seine Sprache und vor allem: er hat durch seine kunstvollen Heimatspiele Schängchen zu seinen Taten verhoffen, durch die es bei jung und alt in Aachen beliebt geworden ist. Drei von ihnen, ein Bildhauer (Alfred Pieper), ein Maler (Willi Kohl) und der Dichter Will Hermanns, waren durch das Gastspiel der süddeutschen Puppenbühne Ivo Puhonny, im Neuen Kurhaus angeregt worden, dem kulturellen Leben Aachens durch Gründung eines künstlerischen Puppentheaters neues Blut zuzuführen. Will Hermanns gibt dazu eine lustige: "Zum Direktor des Unternehmens ernannte sich Pieper, der Bildhauer; er versprach, nicht nur das Kapital zu beschaffen, sondem auch die Bühne zu bauen und als erster Sprecher zu fungieren. Kohl, der Maler erwies sich bald als zu expressionistisch eigenwillig in bezug auf das Bühnenbild, verursachte auch bei gelegentlichem Mitspielen dem künstlerischen Leiter herzbeklemmende Stunden, und bald schied er aus dem „Puppenvätertrio" aus. Dr. Will Hermanns war die Aufgabe zugefallen, das gewünschte lokalhistorische Puppenspiel zu verfassen. So entstand als erstes: „Der Teufel in Aachen". Den lustigen Haupthelden und typischen Vertreter des Aachener Domgrafentums nannte Herrnanns „Schängchen", weil die meisten seiner Vettern im übrigen Reich und jenseits der Grenze auf den Namen Hans hörten vom Wiener Hans Staberl bis zum französischen Jean Potage, zum holländischen Jan Klaasje und zum Kölner Hänneschen. Bei dieser Namengebung fanden sich gleich eine Reihe „wohlwollender Kritiker". Sie fanden es „befremdend", daß ein „aus der französischen Zeit stammender Name" für den Öcher Jong gewählt worden sei. Zur gleichen Zeit wie Hermanns, Pieper und Kohl hatte der Dekorateur Hein Lentzen mit seinem Schwager, dem Ingenieur J. Lausberg, den Bau einer Puppenbühne begonnen. Auf der Suche nach einem Saale trafen die beiden "Unternehmen" zusammen und beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Von der ursprünglichen Absicht, die süddeutsche Marionette Ivo Punhonnys als Darstellerin künftiger Puppendramen zu wählen, kam man bald ab, und man entschied sich für die im Rheinland bodenständige derbe Stabpuppe. Der Bildhauer Pieper schnitzte die Puppen, der Dekorateur Lentzen sorgte für die Bühnenausstattung, und der Ingenieur Lausberg übernahm die technische Einrichtung des gesamten Theaters, die technische Ausrüstung der Puppen und die Darstellung der Figur des Schängchens, der er soviel an eigenem Mutterwitz und nie versagender Schlagfertigkeit mitzugeben gewußt hat, daß sie in kurzer Zeit zu lebendiger Volkstümlichkeit gedieh. |
| Erste Vorstellung: | Am Mittwoch, dem 4. Mai 1921, spielten die „Aachener Marionettenspiele" (wie das Unternehmen zuerst genannt wurde) vor geladenen Gästen zum ersten Male das "Große historische Puppenspiel mit Gesang, Tanz und Keilerei: DER TEUFEL IN AACHEN oder Et Schängche köllt (betrügt) der Krippekratz (Teufel)" von Will Hermanns. Vorher wurde in einem kleinen Bühnenweihfestspiel: „Öcher Klöpp än Kölsche Knuuze" (Der Wettstreit) das Kölner Hänneschen aus dem Felde geschlagen. Der Erfolg war groß. Die Heimatpresse begrüßte einstimmig die Wiederbelebung der alten, kindhaften Vokkunst als „eine wertvolle Unterstützung der jugenderziehung und eine kräfte Förderung gesunder heimischer Wesensart". An den nun folgenden Tagen, Wochen und Monaten drängen sich die Aachener in Scharen zur Kasse des neuen Theaters in der Hartmannstraße. Will Hermanns legt in Wort und Schrift die Ziele des Aachener Puppenspiels dar: „Wir wollen Kunst bringen und wollen es mit Hilfe des volkstümlieben Puppenspiels!". Die Kunst der Puppenbühne ist nach Hermanns Worten „ein eigener Stil, mit anderen Zielsetzungen und anderen Mitteln als die Kunst der großen Bühne, ebenso etwa wie in der Malerei der Holzschnitt gegenüber dem Ölbild". Die Aachener Marionettenspiele sollen, das ist Hermanns Programm, echte, volkstümliche Kunst bringen. Im Dezember 1921 verläßt der „erste" Spielleiter, Franz Heller, die „Marionettenspiele" und gründet eine „Wanderkunst-puppenbühne". Die ersten beiden Jahre, 1921 und 1922, sind für die „Marionettenspiele" in der Hartmannstraße ein großer Erfolg. "Der Teufel in Aachen", "Die drei Wünsche", "Die Trinkerkur", "Genoveva", "Don Juan" und "Der Schmied von Aachen" werden von Will Hennanns aufgeführt, dazu von A. Kocks: "Der Glockenguß zu Aachen". Die Heimatsage und Heimatgeschichte wird wieder lebendig, und die Presse ist der beste Bundesgenosse Schängchens. Fast jede Vorstellung ist ausverkauft. Da kommt der erste große Schlag für den Öcherjong. Am 27. Januar 1922 steht es in allen Aachener Zeitungen zu lesen: Die Gaststätte „Maus", das Spiellokal, ist baupolizeilich ungeeignet. Was ist geschehen? Die bisherige Bühne genügt nicht den „baupolizeilichen Anforderungen", und so muß sie „auf obrigkeitlichen Befehl" ihre Türen schließen. Schängchen ist obdachlos! |
| 1922 | Im März 1922 findet Schängchen im früheren Gasthof „Sankt Martin", Alexanderstraße 6, an der Hotmannspief (Hauptrnannsbrunnen) ein neues und schöneres Heim. Der Spielplan beginnt mit dem „Schmied von Aachen". Im Jahr 1923 erscheinen: "Die Wurmhexen „Schängche als Heiratsvermittler", „Dr. Fausts Höllenfahrt", alle von Will Hermanns. Das Bühnenbild ist in seiner Einfachheit doch künstlerisch. In den folgenden Monaten entstehen noch die mehrer Spiele. Der Grundstein für zukünftige fruchtbringende Erziehungsarbeit ist gelegt. Da ziehen sich neue Wolken über dem Puppenhimmel zusammen. Innere Zwistigkeiten in der Leitung des Puppentheaters führen zum Ausscheiden des beliebten und unnachahmlichen Schängchendarstellers J. Lausberg aus der Reihe der Spieler. |
| 1923 | Ende des Jahres 1923 übernimmt Hein Janssen die literarische Leitung des Puppentheaters „Schängchen an der Hotmannspief". Das Stück „Der Barong Flöckmösch" ist sein erstes Werk an diesem Theater, ein Stück, das schon vor mehreren Jahren als Personenspiel aufgeführt wurde. |
| 1924 | Im Frühjahr 1924 verläßt auch Pieper die „Rumpfleitung" des alten Unternehmens und gründet die „Rheinischen Marionettenspiele", die aber bald das Schicksal der Hellerschen „Wanderkunst- Puppenbühne" teilen müssen. Das Jahr 1924 sieht die „Blüte" des Aachener Puppenspieleifers. Im August eröffnet Will Hermanns die „Aachener Kammer-Puppenspiele", deren Leitung der alte Schängchenspieler J. Lausberg übernimmt. Aachen hat nun drei Puppentheater. Von den Herren Lentzen, Lausberg und Pieper, mit denen Will Hermanns 1921 die „Aachener Marionettenspiele" gründete, hat jeder sein eigenes. In der Folgezeit erweitert Herrnanns seinen Spielplan mehr und mehr. Die Jahrtausendfeier der deutschen Rheinlande eröffnet sein Schängchen als Vertreter des Aachener Volkstums durch einen festlichen Heimatabend, auf dem das historische Puppenspiel "Kaiser Karls Heimkehr" aufgeführt wird. |
| 1925 | Im Mai 1925 gehen die Aachener Kammer-Puppenspiele in den Besitz des Bühnenvolksbundes über. Will Hermanns glaubt mit diesem Schritt sein Schängchen in sicherer Hut. Noch manches Stück wird für diese Puppenbühne erdacht. Dann kam auch hier das Ende. Am 5. Geburtstag Schängchens, am 4. Mai 1926, sagte Hermanns in einem Vortrag: „Die Aachener Kammer-Puppenspiele haben bis auf bessere Zeiten ihre Tore geschlossen." Währenddessen hat das „Schängchen an der Hotmannspief" unter der Leitung von Hein Lentzen und der literarischen Betreuung durch Heinz Janssen viele Erfolge, aber auch großen Kummer. Neben Janssens Spielen waren einige von Horbach, Holzmann und Dithmar auf dem Spielplan. Von der Begeisterung im Volk für die liebenswerte Kleinkunst angespornt, dichteten die Freunde Prof. Peter Mennicken und Otto Foulon unter dem Pseudonym „Peter Walker" ein vielbeachtetes Heimatspiel „De Prente än der jrueße Stadtbrank va 1656". |
| 1933 | Mit dem Tode Hein Lentzens 1933 werden die Schwierigkeiten noch größer. Frau Lentzen übernimmt die Leitung und hält unter den größten Opfern mit ihren Helflern das Unternehmen aufrecht. |
| 1935 | Am 1. Oktober 1935 begann für die Puppenbühne unter der künstlerischen Leitung von Will Hermanns und der Mitwirkung des Ehepaares Peter Hermann und Hanna Loosen, das der kleinen Bühne mehr als 25 Jahre lang wertvolle Impulse gab, eine neue zukunftsversprechende Ära. Die „Honorierung" der acht Spielkräfte wurde aus den Einnahmen der Vorstellungen bestritten. Die geringen Beträge wurden gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt. Was sich dabei ergab, waren keine Geheimnisse. Der Weiße Saal im Alten Kurhaus hatte 100 Sitzplätze. Die Eintrittspreise betrugen 0,40 DM für Erwachsene und 0,20 DM für Kinder. Gespielt wurde mittwochnachmittags, samstagabends, sonntagnachmittags und -abends (bei großem Andrang wurde sonntagnachmittags eine Vorstellung eingeschoben). Die Spiele dauerten 1 1/2 bis 2 Stunden. Bewundernswert waren der Idealismus und die Spielbegeisterung der Spielgruppe, die von der Laienbühne her qualifizierte Ergänzung erhalten hatte. Die Resonanz beim kleinen und großen Publikum war entsprechend groß. Das „Öcher Schängchen" gewann rasch einen enormen Zulauf. Aber der kleine Rahmen ließ einen entsprechenden Aufstieg nicht zu: Theatersaal, Bühne und Requisitenkammer blieben klein. Daß die Spielgruppe um das „Schängchen" trotzdem aushielt, bleibt ihr ungeschmälerter Verdienst. Will Hermanns schrieb zum Auftakt eines seiner besten „Zugstücke", die „Klöppelezupp", die 25mal im November 1935 aufgefüihrt wurde. Fritz Dreher, ein Leben lang Opernsänger am Aachener Stadttheater, wurde künstlerischer und musikalischer Mentor der Spielgruppe. Der damalige Kulturdezernent, Stadtdirektor Walter Zieger, begann der Puppenbühne ein breites Spiel zu erschließen. Versuche, die Spiele weltanschaulich-politisch zu dirigieren, verstanden das Schängchen und seine Getreuen dank des Blütenreichtums ihrer Mundart, die für fremde Ohren wie eine Mandarinensprache klang, für „Hörende" zwar gewagte, aber köstliche „Eulenspiegelei" war, sich elegant zu entwinden. |
| 1936 | Schon 1936 nahm die Aachener Puppenbühne aktiv am öffentlichen Aachener Karneval teil. Im Rosenmontagszug jenes Jahres stellte sie zum ersten Male einen Kamevalswagen, auf dem nicht nur die Puppen, sondem auch die Angehörigen der Spielgruppe sich kostümiert präsentierten. Motiv des Wagens war ein heiteres Spiel, das gerade auf dem Programm stand und großen Anklang fand wegen des amüsant persiflierten aktuellen Themas. |
| 1938 | Bemerkenswerte Stationen waren 1938 der Besuch fahrender Persönlichkeiten des amerikanischen und englischen Puppenspiels. Anfang 1942 wechselte das Schängchen sein Domizil vom Alten Kurhaus in das Mittelstandshaus in der Wirichsbongardstraße, das die Stadt erworben hatte und dessen großen Saal mit mehr als 200 Sitzplätzen sie von Bert Heller (der auch viele Bühnendekorationeu für das Schängchen schuf geschmackvoll-dekorativ herrichten ließ.

Schängchen
|
| 1943 | Hier spielte das Schängchen seine fröhlichen Spiele bis zum Juli 1943 und verlor dann innerhalb weniger Stunden bei einem Brandbombenangriff seinen gesamten Bestand an Puppen, Kostümen, Requisiten und technischen Anlagen. Das „Öcher Schängchen" war nur noch eine Erinnerung in den Herzen! Diese in den Herzen verankerte Erinnerung blieb lebendig. Die Stadt schien noch wie gelähmt, da regte sich schon wieder der Wille zum Leben. Dieser Lebenswille umschloß auch kulturelle Interessen. So war es das Anliegen einiger aufgeschlossener Bürger, auch das mit Brauchtum und Mundart vefwachsene Aachener Puppenspiel wieder entstehen zu lassen. Sepp Schüller bemühte sich, zu den bereits wieder erreichbaren ehemaligen Puppeiispielem neue interessierte Akteure zu gewinnen. |
| 1946 | Und im Winter 1946 konnte im Vortragssaal der Stadtbücherei in der Peterstraße das alte Spiel mit neuen Puppen, Kostümen und Dekorationen auf bretterloser neuer Bühne neu beginnen. Paul Schneeloch leitete das Spiel und entwarf die Bühnenbilder. Hein Goergen, der „Spitzweg" unter den Aachener Mundartdichtern, schrieb eigens für dieses neue Schängchen einen Spieltext mit viel Lokalkolorit. In der Kostümbildnerei des Stadttheaters wurden die Puppenkostüme, kleine Kunstwerke, von Ursula Groeger hergestellt. Spiele alter Tradition fanden ein großes Publikum. Aber das Neue bei diesem Wiederbeginn war, daß die Bühne als städtische Einrichtung geführt wurde und somit die Puppenspieler zum ersten Male in einem festen Vertragsverhältnis standen. Doch kaum hatte man sich dieses Glückfalls erfreut, da war es auch schon wieder vorbei: Der Tag X im Oktober 1948 kam und brachte das Ende. Der städtische Spielbetrieb wurde eingestellt und den Puppenspielem das Vertragsverhältnis gekündigt. Einige der Spieler fanden in ihre alten Berufe zurück oder nahmen neue Beschäftigungen auf. Andere blieben und vereinten sich mit den Spielern der alten „Schängchen"-Spielschar der dreißiger Jahre zu einer neuen Spielgruppe unter der Leitung von Will Hermanns, dem die Stadt die Bühneneinrichtung zur Verfügung gestellt hatte, mit dem Ziel, in freier Gemeinschaft der Spieler die Vorstellungen weiterzuführen. |
| 1951 / 1952 | Weitsichtige Menschen hüben und drüben am Dreiländereck hatten sich schon schnell wieder bemüht, kulturelle Verbindungen miteinander aufzunehmen. Dem Schängchen war es vergönnt, den ersten kulturellen Brückenschlag zu den niederländischen Nachbarn zu verwirklichen. Man erinnerte sich in Kerkrade an Gastspiele der Aachener Puppenspiele in den zwanziger Jahren. Die Freunde aus Kerkrade luden das Schängchen zu einem Besuch ein. Termin war Donnerstag, der 4. Januar 1951. Veranstalter der Studentenklub St. Larnbertus. Spielort der Theatersaal im Hubertushaus (600 Plätze). Der Ruf des Schängchen-Gastspiels war auch nach Schinveld gelangt. So kam ein Jahr später die Einladung zu mehreren Gastspielen, die am 12. und 13. Januar 1952 im Patronatssaal vor mehr als 2.000 Zuschauern stattfanden. |
| 1952 | Auch der Spielbetrieb in der Peterstraße war nur ein Provisorium, das endlich 1952 ein Ende fand, als der Rat der Stadt beschloß, „Schängchen" wieder in städtische Obhut zu nehmen, ihm gleichzeitig aber auch eine bessere Heimstatt zu bieten. Dies sollte in der Werkkunstschule der Stadt sein, wo die Aula mit einem bereits vorhandenen Bühnenpodium und Vorhang die Möglichkeit zum Aufbau der Stockpuppenbühne und zu Vorstellungen gab. Aber Schulbetrieb und Theateruntemehmen unter einem Dach und ebenfalls auf engstem Raum ergaben mehr Reibungsflächen, als man ursprünglich voraussah. |
| 1954 | So übersiedelte die Puppenbühne 1954 in das Jugendheim Kalverbenden im Stadtteil Burtscheid, das zwar an der Peripherie der Stadt lag, aber bessere Entwicklungsaussichten erwarten ließ. 
Marktfrau Hazzor
|
| 1963 - 1970 | Im Jahre 1963 formierte sich die Spielgruppe neu. Ausgeschiedene, alte bewährte Kräfte wurden durch neue ersetzt, die sich mit der gleichen Freude und Opferbereitschaft wie die "Ehemaligen", weiterhin der Bühne angehörten, ihrer schönen Aufgabe annahmen. Bühnenbildner Matthias Stevens vom Stadttheater Aachen, ehemals Puppenspieler in den Jahren 1946 bis 1948, ist seit 1963 künstlerischer Leiter der kleinen Bühne mit der eminent großen Breitenvirkung. Nach der Neufoemierung der Spielgemeinschaft lag die wichtigste Aufgabe zunächst in der Ausbildung der neuen Ensemblemitglieder. Während der spielfreien Sommerzeit 1963 wurden die sprachlichen, musikalischen und technischen Feinheiten des Puppenspielers hart erarbeitet. Im Herbst begann dann der Spielbetrieb. Mit großem Engagement wurden die traditionellen Stücke nach und nach zur Aufführung gebracht. Neben den sonntäglichen Vorstellungen gab es an jedem Samstag für die Aachener Schulen Vorstellungen, um der Aufgabe zur Erhaltung und Verbreitung der Aachener Mundart und des Rheinischen Stockpuppenspiels nachzukommen. Die aus damaliger Sicht weit vom Zentrum entfernt liegende Spielstätte im Jugendheim Kalverbenden im Stadtteil Burtscheid hinderte die Besucher jedoch nicht, die Vorstellungen zu besuchen. Ohne Übertreibung darf festgestellt werden, daß jung und alt in Scharen dem Schängchen die Aufwartung machten, wobei oftmals viele Besucher wegen Überfüllung abgewiesen werden mußten. Bei den jüngeren und jüiigsten Zuschauern flossen dann hin und wieder Tränen. Dies kommt auch heute noch vor. Über Jahre hinweg wurde die Bühnentechnik verbessert, die Bühnenbilder und der Kostümfundus erweitert. Nicht zu vergessen natürlich die Hauptdanteller, die Puppen. Nach und nach kamen neue Puppen mit neuen, für sie typischen Merkmalen hinzu, wodurch die hölzerne Spielgemeinschaft zu heutiger Größe anwuchs. Das Ensemble fand sich während der folgenden Jahre ebenfalls zu einer verschworenen Gruppe zusammen. Aber der Generationswechsel deutete sich schon an. Ältere, hochverdiente Spieler schieden aus, jüngere kamen hinzu. Mitte der 70er Jahre zeigte sich, daß der Spielbetrieb von seiner künstlerischen, technischen und räumlichen Leistungsfähigkeit an Grenzen gestoßen war. |
| 1982 | Nach langwieriger Suche unter großer Mithilfe aller beteiligter städtischer Ämter und Institutionen wurde im Jahr 1982, in der zu einem Kulturzentrum umgestalteten, ehemaligen Tuchfabrik am Löhergraben, eine neue - nunmehr die achte Spielstätte gefunden. Die Gunst der Stunde erlaubte es, in diesem Gebäude einen Puppenbühnenbau zu verwirklichen, der allen Anforderungen eines modernen und zukunftsträchtigen Spielbetriebs vollauf genügte. Hier ist dem damaligen Spielleiter, Matthias Stevens, und dem Architekten, Winfried Wolks, in besonderer Weise zu danken. Mit Recht wird das Schängchen von anderen Puppentheatern um diese Spielstätte beneidet. Die großartige Verbesserung der Spielmöglichkeiten druckte sich zum Erstaunen des Publikums schon in der ersten Vorstellung am Samstag, dem 16. Januar 1982, mit dem Stück „Der goldene Mann" von Prof. Peter Mennicken aus. Die günstigen Bedingungen boten der Spieldramaturgie enorme Perspektiven. Optische Verwandlungen des Bühnenbildes bei geöffneter Bühne, Lichtprojektionen und erweiterte Toneffekte förderten den Spielablauf. Die sprachliche und musikalische Probenarbeit konnte durch einen erstmals vorhandenen Aufenthaltsraum erheblich intensiviert werden. Der Erfolg all dieser Maßnahmen machte sich an den positiven Reaktionen des Publikums deutlich. Weiter konnte sich das Schängchen an den ersten öffentlichen Veranstaltungen zur Einweihung des "Grenzlandradios" des WDR, Studio Aachen, beteiligen. Herausragende Gastspiele fanden und finden u.a. in Maastricht/NL, Kerkrade/NL, Hasselt7B, Eupen/B, Berlin, Bochum und in der Aachener Nachbarstadt Würselen statt. Wie in den früheren Jahren so gab es auch in den letzten Jahren Szenenauftritte und Aufnahmen im Femsehprograrnm des Westdeutschen Rundfunks sowie den örtlichen Rundfunksendem. Die enge Verbindung der Aachener zu ihrem Schängchen zeigt sich beispielhaft seit vielen Jahren in der Gestaltung von Kamevalsorden. Vielfältige Motive von Typen der Puppenbühne werden als Vorlage hierfür gewählt. Wie schon vor dem II. Weltkrieg so nahmen die Puppen auch danach an den Kinderkarnevalsumzügen teil. |
| 1984 | Die öffentliche Anerkennung der künstlerischen Leistungen blieb nicht aus: Im Jahr 1984 wurde der Bühne |
| 1985 | der "Preis für europäische Regionalkultur" und 1985 der "Thouet-Preis zur Förderung und Pflege |
| 1989 | Aachener Mundart" verliehen. Als besonders ehrenvoll empfand die Bühne den Auftrag, als kultureller |
| Auszeichnungen: | Beitrag die Stadt Aachen beim Nordrhein-WestfalenFest 1989 in Düsseldorf zu vertreten. 
Nieres
Es wurde das Stück "De Prente" von Prof. Peter Mennicken an zwei Tagen mehrfach gespielt. |
| 1989 | Der schon angesprochene Generationswechsel im Ensemble wurde kontinuierlich fortgesetzt. So legte im Jahr 1989 Herr Matthias Stevens nach 26-jähriger Spielleitertätigkeit diese Aufgabe in jüngere Hände. Mit Beginn der Spielzeit 1989/90 folgte ihm das Ensemblemitglied Otto Trebels. Er kann aber weiterhin auf die reiche Erfahrung und die Ratschläge seines Vorgängers vertrauen, der der Bühne als Ausstattungsleiter und Bühnenbildner erhalten bleibt. Der jetzige künstlerische Leiter sah und sieht sich im besonderen vor vier Aufgaben gestellt: Zum ersten die weitere Verjüngung des Ensembles. Zum zweiten die Anpassung des gesamten technischen Bühnenapparates auf heutige Verhältnisse. Zum dritten die qualitative Weiterentwicklung des Stockpuppenspiels. Zum vierten - wie alle seine Vorgänger - die Suche nach spielbaren Stücktexten mit aktuellem Bezug. Die Erfüllung der ersten Aufgabe wird möglich durch die Tatsache, daß es immer noch junge Menschen gibt, die sich dem Puppenspiel in der Kombination von Puppenspieltechnik, Beherrschung der Aachener Mundart und musikalischer Fähigkeiten stellen und in ihren Vorgängern Puppenspielerinnen und Puppenspieler finden, die ihren großen Erfahrungsschatz weitergeben und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die zweite Aufgabe erfüllte sich in den letzten Jahren in Teilbereichen durch den Einbau einer aufwendigen computergesteuerten Licht- und Tonanlage. Die dritte Aufgabe kann eigentlich nie erfüllt werden, da es eine ständige Weiterentwicklung im Puppenspiel geben muß und geben wird und auch dieses Theater sich der Konkurrenz eines überwältigenden Angebotes an anderen kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen gegenübergestellt sieht. Dies fordert die Kreativität aller an diesem Theater tätigen Mitarbeiter heraus. Die Suche nach geeigneten Stücktexten, möglichst mit heutigem und aktuellem Bezug, gestaltet sich deshalb so schwer, weil es nur wenigen Autoren gelingt, die Grundbedingungen für das Puppenspiel des Öcher Schängchen's zu vereinigen. |
| 1992 | Für das Jahr 1992 ist als außergewöhnliches Ereignis in der Erinnerung aller Beteiligter der Auftritt vor den von der Stadt Aachen eingeladenen, ehemaligen jüdischen Mitbürgem haften geblieben. In jüngerer Zeit öffnet sich die Puppenbühne den jüngeren Fans mit der Möglichkeit, in Workshops das Stockpuppenspiel zu erlernen. Die Reaktionen hierauf ermutigen, auf diesem Wege fortzufahren |
| 1996 | Seit der Spielzeit 1995/1996 führt die Puppenbühne mit großem Erfolg Karnevalsveranstaltungen unter dem Titel "Öcher fiere met et Schängche Fastelovvend". Hier wird ein echter Mitmach-Karneval geboten, indem das Publikum einer der Akteure ist. Das Ensemble, arrivierte und Nachwuchskarnevalisten und - wie gesagt - das Publikum bilden eine Einheit, die bemüht ist, echte karnevalistische Stimmung ohne kommerziellen Hintergrund zu schaffen. Diese Veranstaltungen sind derartig "eingeschlagen", dass die örtliche Presse schon im ersten Jahr von |
| 2000 | einer "Kultveranstaltung" sprach. Erstmalig in der Spielzeit 1999/2000 haben wir den 1. Donnerstag im Monat zum "Schängchen-Tag" erklärt. An diesem Tag spielen wir jeweils ein Erwachsenenstück, um der gestiegenen Nachfrage nach derartigen Aufführungen nachkommen zu können. Am 19. Januar 2000 war das Schängchen eingeladen, sich an der WDR-Fernseh-Talkshow "mittwochs mit...." zu beteiligten. Die Gattin des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Frau Karin Clement, war dort zu Gast und ihr war als "Landesmutter" die Aufgabe gestellt, einige Mundarten aus NRW zu erraten. Der Auftritt von Hubert Crott (Schängchen) und Otto Trebels (Veries) hatte laut WDR eine sehr gute landesweite Resonanz. |
| 2001 | Am 19. und 20.08.2000 beteiligte sich die Bühne mit mehreren Vorstellungen im sog. Kreuzgang des Domes am "Domfest 2000". Weiter haben wir uns am 23.09.2000 an dem erstmalig durchgeführten "Aachener Theatertag" beteiligt und in dessen Rahmen, wie alle anderen Theater auch, das Frage-Antwort-Stück "Quizoola" aufgeführt. Am 4.5.2001 feierte das Öcher Schängchen seinen 80. Geburtstag. Die Geburtstagsfeier wurde auf den 30.8.2002 verschoben, um an diesem Tag auch die ehemaligen Ensemble-Mitglieder Hans Alt (im Juni 80 Jahre alt) und Maria Schmitz (im Juli 90 Jahre alt) zu ehren. Ebenfalls konnte das Ensemblemitglied, Frau Alma Straeten, im Juni ihren 70. Geburtstag feiern. |
| 2002 | Herr Oberbürgermeisters Dr. Jürgen Linden erinnerte in seiner Begrüßungansprache an die wechselvolle Geschichte der Puppenbühne und an die Bedeutung dieser Einrichtung für die Bürger der Stadt. Herr Dr. Manfred Birmans hielt den Festvortrag mit besonderer Betrachtung der Gründer der Bühne. Der Spielleiter Otto Trebels erläuterte an Hand eines Bildervortrags die acht Spielstätten des Öcher Schängchens in den vergangenen Jahrzehnten. |


 Stumble It!
Stumble It!